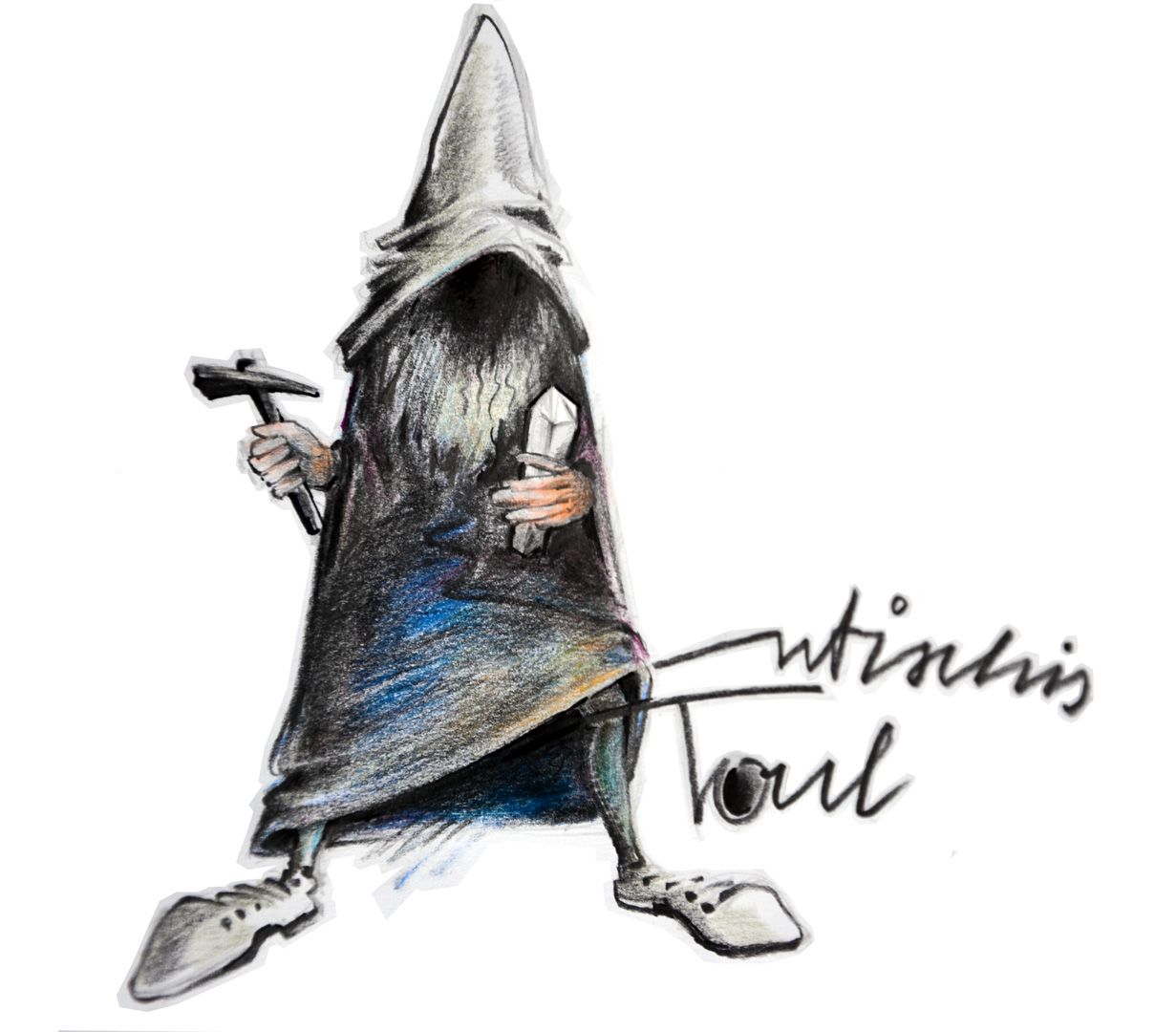- START
- PROJEKT
- GESCHICHTE
- WAS UNS SAGEN SAGEN – Katrin Gschleier
- SAGENWANDERUNG - mit Margareta Fuchs
- EINE REISE – ins Val Camonica
- DER MEILER – eintauchen in die Vergangenheit
- ANTRISCHE PLAUDEREI – mit Karl Gruber
- ANTRISCHE LÖCHER – mit Johannes Ortner
- ARCHÄOLOGIE – mit Ingemar Gräber
- ANTRISCHE SCHRIFT – entdeckt im Hollenzbach
- KREATIV
- DIE ANTRISCHEN – Der Film
- ANTRISCHE SAGEN – das Hörbuch
- HOAGOSCHT – Gschichtlan aus Weißenbach
- DUNKEL DIE NACHT – ein Freilufttheater
- ANTRISCHA TRÖPFN – Literatur und Musik
- SAGENHAFTES AHRNTAL – ein Sagenbuch
- DAS WOLLKNÄUEL – eine Spurensuche
- LOCH IM GEIST – poetische Performance
- VERSUNKEN IN SAGEN UND MYTHEN - Schreibwerkstatt
- DIE ANTRISCHEN LERNEN DIE MODERNE KENNEN - Schreibwerkstatt
- ANTRISCH – ein Exposé
- ANTRISCHO – Freilichttheater Nikolausstollen
- ANTRISCH GEDICHTET– mit Paul und Klothilde
- ZUR NOTFELDLOCKE – eine Wanderung
- KRÄUTERWANDERUNG – in Stöckma Röe
- MAKE a MONSTER – ein Bastelspaß
- WANDERN
- SAGEN
- ANREISE
Jeder Meiler hat seinen eigenen Kopf
Im Ahrntal wurde bereits seit der Bronzezeit vor allem Kupfer abgebaut und verhüttet. Unmengen von Kohle wurde für Schmelzöfen und Schmieden des Prettauer Kupferbergwerks benötigt. Schon um 1500 war das Holz so knapp, dass ab da sämtliches Holz für die Gewerken des Bergwerks reserviert wurde. In den Holzwerken des Prettauer Bergwerks waren saisonal zwischen 50 und 100 Arbeiter beschäftigt.
Initiator war der Geschichtsverein Ahrntal
Der Köhler
Ach, wer hätte das gedacht,
dass man aus Holz noch Kohle macht.
Schon dreitausend Jahr und noch länger,
gibt es diese braven Männer,
die aus Eichen und aus Buchen
viele solche Meiler schufen.
Die schwarze Kohl als Labung
bei Bauchweh und bei Darmversagung
auch zum Glockenguss und Pulver machen
benötigt man die schwarzen Sachen,
so ist es schad um diese Zunft,
denn „ Köhlern“, dies ist eine Kunst.
Historisch: Kohlewerke für das Bergwerk

Im Ahrntal wurde bereits seit der Bronzezeit vor allem Kupfer abgebaut und verhüttet. Unmengen von Kohle wurde für Schmelzöfen und Schmieden des Prettauer Kupferbergwerks benötigt. Schon um 1500 war das Holz so knapp, dass ab da sämtliches Holz für die Gewerken des Bergwerks reserviert wurde. In den Holzwerken des Prettauer Bergwerks waren saisonal zwischen 50 und 100 Arbeiter beschäftigt. Sie besorgten neben dem Gruben- und Röstholz vor allem die Kohle für die Schmelzwerke. In den Kohlewerken wurden zwischen 40 und 50 Arbeiter benötigt um die Meiler fachgerecht zu setzen und das Brennen zu überwachen. In der „Memory“ von Hans Pfarrkircher von 1573 steht, „dass 7 Männer 8 Tage benötigten um 1800 bis 2000 Holzprügel zu zersägen und den Meiler fachgerecht zu setzen. Anderthalb Tagen brauchten sie dann, um ihn zuzudecken und feuerfertig zu machen. Dann brannte der Haufen je nach Wetter vierzehn bis fünfzehn Tage lang. Von einem Meiler gewann man im Allgemeinen sechzig Fuder Kohle. Mit eineinhalb bis zwei Fudern konnte ein Wiener Zentner Kupfer geschmolzen werden. Nach dem Niedergang des Bergbaues kam die Köhlerei Ende des 19. Jahrhunderts allmählich zum Erliegen. Heute weisen noch Flurnamen wie „Kohlstatt, Kohlgrube oder Kohlplatzl“ auf Kohlplätze und Kohlewerke hin. Das Handwerk geriet in Vergessenheit.
Auf den Spuren eines alten Handwerks
Der Geschichtsverein Ahrntal hat sich zum Ziel gesetzt einen Kohlemeiler nach historischem Vorbild aufzubauen und die Arbeit des Köhlers wiederzubeleben. Mit Hilfe von Ludwig Hutter, einem Köhler aus Bayern und den Mitgliedern des Vereins wurde dieses Vorhaben im August 2020 umgesetzt. Von Köhler Ludwig bekamen wir in einem ersten Treffen viel Information und eine lange Liste mit Materialien, die für die Errichtung des Kohlemeilers notwendig sind. 10 m³ trockenes Brennholz, ein Meter lang, oberarmdick gespalten, einen Kipper mit Tax (=grüne Fichtenzweige), 7 m³ Erde, zusätzlich Bretter und Schwarten, längere und kürzere, dickere und dünnere Stämme und dazu viel Werkzeug für die einzelnen Phasen der Errichtung des Meilers, eine einigermaßen angenehme Unterkunft für die kurzen Schlafpausen in der Nacht, eine Zuleitung fürs benötigte Wasser und ein Stromaggregat für eventuelle Notfälle. Der Geschichtsverein klopfte an viele Türen, fand überall offenen Ohren und so stand zum vereinbarten Termin alles zur Verfügung. Ludwig aus Bad Kohlgrub hatte mit „Reiner“ Unterstützung aus dem Elsass mitgebracht und gemeinsam wurde der Meiler aus heimischen Fichten- und Lärchenholz innerhalb von 2 Tagen aufgebaut.
Anzünden und langes Wachen
Am Montag, den 11. August um 10 Uhr wurde der Meiler von oben entzündet. Entgegen den Erwartungen brannte das Kleinholz im Quandelschacht nicht so wie es sollte, der Starkregen am Nachmittag trug seines dazu bei, sodass der Verkohlungsprozess am ersten Tag nicht wirklich in Gang kam. Daher musste der Meiler am 2. Tag noch einmal entzündet werden.
Jeder Meiler hat seinen eigenen Kopf, daher muss er auch 24 Stunden beobachtet werden. Hat der Rauch eine weiße Farbe, rührt diese vom Wasserdampf her, raucht es bläulich, gibt es Verbrennung und wenn nicht eingegriffen wird, bleibt nur mehr Asche. Brauner Rauch zeigt an, dass der Verkohlungsprozess wie gewünscht abläuft. Die „Arena“ hinter dem Damm in der „Dörfl-Kahle“ im Dorfe Weißenbach, auch „Eisllöech“ genannt, mit Blick zum Tristenstein im Westen, dem Schönberg im Norden und die Ahrntaler Berge im Osten bot (fast) alles, was ein guter Kohlplatz haben muss. Die Stelle liegt abseits bewohnter Gebiete und ist trotzdem in kurzer Zeit vom Dorf aus erreichbar. Auch das notwendige Wasser ist ausreichend vorhanden. Einzig der Wind blies unerwartet konstant vom Kahlbach herunter und erschwerte ein gleichmäßiges Verkohlen des Meilers. „Der Wind ist der Feind des Köhlers,“ meinte Ludwig einmal. Mit einer Eisenstange wurde anhand von kleinen Öffnungen der Verkohlungsprozess langsam nach untern geführt. „Wenn´s drinnen raschelt, dann weiß ich, dass ich Kohle hab,“ sagt Ludwig. Gelegentliche zusätzliche Luftzufuhr am Boden heizte den Meiler an. Der Haufen sackte inzwischen im Laufe der Tage zusammen, Löcher und Hohlräume wurden gestopft. Mit dem Warhammer wurde die Kuppel des Meilers verdichtet und die Rüstung langsam zurückbebaut. Am Abend, nachdem die letzten Tagesbesucher sich verabschiedet hatten, wurde ein wärmendes Feuer entzündet und es begann das lange Wachen. Zwischendurch Holz nachlegen, eine Runde um den Meiler, ab und zu etwas Wässern, wenn der Meiler weiße Flecken bekam. Abwechselnd durfte einer schlafen, der andere wachte. Gegen 5 Uhr wurde es wieder heller, das Beobachten des Meilers einfacher.
Jeder Tag bot viel Arbeit und auch ein Rahmenprogramm
18. August: ganztägiges experimentelles Kupferschmelzen
20. August: Aufführung der poetischen Performance „DAS LOCH IM GEIST“
22. August: Entzünden eines Kindermeilers
24. August: Heike Tschenett ist für die Radiosendung „Unser Land“ auf Besuch am Meiler
Nebenbei wurde Zeichenkohle gebrannt und Stockbrot gebacken.
Der Tag der Offenbarung: Das Ausziehen
Ludwig lacht: „Verlust ist erst, wenn wir Asche haben.“ Nach 8 Tagen gab der Köhler grünes Licht, den Meiler zu öffnen und den ersten Teil der Kohle zu entnehmen. In der Köhlersprache wird dies „ausziehen“ genannt. Dabei wird die Hülle aus Erde und Tax entfernt, die etwa 550 Grad heiße Kohle mit reichlich Wasser „gelöscht“ und mit Rechen streifenförmig neben dem Meiler verteilt, damit vorhandene Glutnester rasch entdeckt und gelöscht werden können, immer gemäß dem Grundsatz: „So viel Wasser wie nötig, aber so wenig wie möglich“, denn das Wasser verschlechtert die Qualität der Kohle. Nachdem sichergestellt war, dass die letzten Glutnester erloschen waren, konnte mit dem Absacken der Kohle begonnen werden. Dank der guten Organisation und der vielen anpackenden Hände ging diese stinkende und staubige Arbeit gut voran und bald war die Kohle in Papiersäcken verpackt und zum Abtransport gestapelt. Während die Kohle viele Jahrhunderte lang einen wichtigen Nebenerwerb für die bäuerliche Bevölkerung des Ahrntales bedeutete und in den Schmelzöfen des Ahrner Handels war, wird der Jahrgang 2020 in den meisten Fällen heimische Grillstellen befeuern. Ein Teil der Kohle wird die bisher verwendete Steinkohle beim Schmieden ersetzen
Projekt getragen von:
Geschichtsverein Ahrntal
Bildungsausschüssen Ahrntal
Bildungsausschuss Prettau
Gemeinde Ahrntal
Gemeinde Prettau
in Zusammenarbeit mit
Vereinen aus der Gemeinde Ahrntal und Prettau